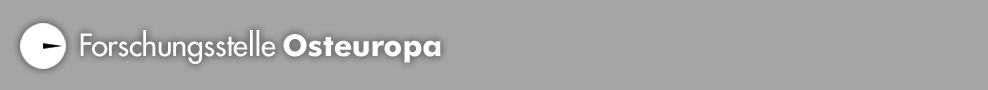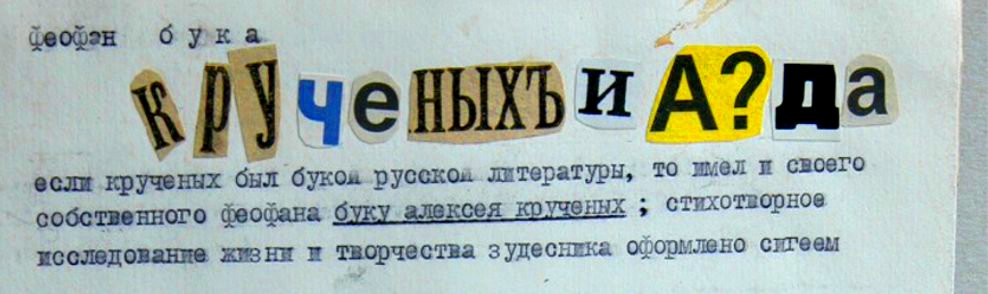Buchvorstellung und Gespräch/ Kolloquium
18:00 Uhr, Europapunkt
Ein Russland nach Putin?
mit Jens Siegert und Susanne Schattenberg
CfP: Coming to the Surface or Going Underground? Art Practices, Actors, and Lifestyles in the Soviet Union of the 1950s-1970s
The Research Centre for East European Studies (FSO), Bremen, November 13-14, 2025
Summerschool European Network Remembrance and Solidarity
25.-26. August 2025 (online), 1.-10. September 2025
Bremen und Paris; Prag und Paris
Wissenswertes
Mit den Augen einer Mutter: Wladimir Bukowskis Ausweisung aus der Sowjetunion
Zum 40. Jahrestag des Gefangenenaustauschs Corvalán - Bukowski in Zürich

© Christian Vioujard, Pressekonferenz in Zürich, 19. Dezember 1976, FSO F. 01-96
„Sie lassen ihn frei! Sie lassen Wolodka frei!“ – Wie ein Schlag mit der Axt auf den Kopf habe es sich angefühlt, als am 14. Dezember 1976 zwei KGB-Mitarbeiter zu Nina Bukowskaja kamen und mitteilten, dass ihr im Gefängnis internierter Sohn Wladimir gegen den inhaftierten chilenischen KP-Führer Luis Corvalán ausgetauscht werden solle. Im Januar 1972 war Bukowski wegen antisowjetischer Agitation und Propaganda zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun sollte in drei Tagen seine überraschende Entlassung erfolgen. Sie würde endlich ihren Sohn wiedersehen, den die Gefängnisleitung durch wiederholte Besuchsverbote isoliert und von dem sie seit Monaten kein Lebenszeichen mehr erhalten hatte. Unsere Archivalien des Monats dokumentieren die Momente des Bangens und Wiedersehens.
Der Gefangenenaustausch Corvalán – Bukowski gilt nicht nur als diplomatischer Erfolg, sondern als bedeutendes Medienereignis im Kalten Krieg. Die bereits bestehenden Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und Chile zur Freilassung des KP-Führers Luis Corvalán, der nach dem Putsch Pinochets verhaftet worden war, hatten durch die erneute Vermittlung der USA im November 1976 Fahrt aufgenommen. Der Präsidentschaftskandidat Jimmy Carter erklärte die Einhaltung der Menschenrechte zur obersten Priorität. Damit war auch der chilenischen Militärjunta als US-Verbündeten klar, dass der Druck auf sie zukünftig steigen würde und eine schnelle Freilassung Corvaláns in ihrem Interesse lag. Warum die Wahl der sowjetischen Führung auf Bukowski fiel, ist aufgrund geschlossener Archivbestände nicht umfassend geklärt. Der Bekanntheitsgrad des damals 34-jährigen Moskauer Dissidenten war in Westeuropa und den USA aufgrund zahlreicher Kampagnen von Menschenrechtsaktivisten hoch, allerdings wären auch andere inhaftierte sowjetische Regimekritiker für einen Austausch in Frage gekommen.
Hinreichend belegt ist die Vorgehensweise der sowjetischen Behörden. Bukowski wurde weder amnestiert, noch kam es zur Aufhebung des Gerichtsurteils gegen ihn. Er wurde durch einen Befehl des Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR N. Podgorni direkt aus dem Strafvollzug aus der Sowjetunion ausgewiesen und erst während seines Transports Richtung Flughafen über den bevorstehenden Austausch informiert. Er fürchtete, er werde verschleppt, und glaubte angesichts des Kontrollverlusts, innerlich zu zerbersten, wie er in seinen Erinnerungen beschrieb.

Manuskript von Nina Bukowskaja, ohne Datum, FSO F. 01-96
Auch seine Mutter Nina Bukowskaja befand sich in den Tagen vor ihrer überstürzten Ausreise in einer Achterbahn widersprüchlicher Gedanken und Gefühle. Unzählige Fragen stellten sich angesichts der Unfassbarkeit des Ereignisses und der kurzen Vorbereitungszeit. Wurde sie getäuscht und ausgeflogen, während ihr Sohn im Gefängnis bleiben würde? Welche Moskauer Dissidentenfreunde sollte sie als erstes über die unheimliche Nachricht informieren? Machte es Sinn, ihrem Sohn Kleidungsstücke zu besorgen oder würde er diese im Ausland ohnehin nicht tragen? Immer wieder nahmen ihre Zweifel überhand. Die Anspannung fiel erst in Zürich von ihr ab, wo sie endlich wieder die Nähe ihres Sohnes spüren konnte. Während sich Bukowski im Blitzlichtgewitter der Kameras vordergründig als Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte präsentierte, gelang es dem französischen Fotograf Christian Vioujard hinter den Kulissen einen intimen Moment zwischen Mutter und Sohn dokumentarisch einzufangen. 1998 übergab die Tochter Nina Bukowskajas deren Materialien dem Archiv der FSO, darunter zahlreiche Fotografien und bisher unveröffentlichten Notizen, in der sie die Ausreise aus ihrer Perspektive schilderte.
Lesetipps:
Bukowski, Wladimir: Wind vor dem Eisgang, Frankfurt am Main 1978.
Ulianova, Olga: Corvalán for Bukovsky: A real exchange of prisoners during an imaginary war. The Chilean Dictatorship, the Soviet Union and US mediation, 1973-1976, in: Cold War History 14 (2014) 3, S. 315-336.
Manuela Putz
Länder-Analysen
Die Länder-Analysen bieten regelmäßig kompetente Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Alle Länder-Analysen können kostenlos abonniert werden und sind online archiviert.
» Länder-Analysen
» Eastern Europe - Analytical Digests
» Länder-Analysen
» Eastern Europe - Analytical Digests
Discuss Data
Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu
» Russian street art against war
» Dissens in der UdSSR
» Duma-Debatten
» 20 Jahre Putin
» Protest in Russland
» Annexion der Krim
» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR
» Mauerfall 1989