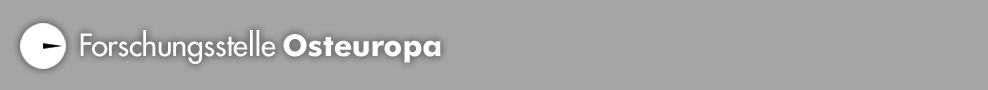Kolloquiumsvortrag
18:15 Uhr, / Zoom
Benjamin Goossen (Boston)
Mennonites and Lebensraum. Situating a Christian Denomination in Hitlers Empire.
Wissenswertes
Arbeit als erstes Lebensbedürfnis? Eine Kulturgeschichte der Arbeit in der Sowjetunion, 1950-1991.
Laufendes Forschungsprojekt von A. Oberländer
Die sowjetischen 1960er und 1970er Jahre gelten bis heute unter den Historiker_innen als die Jahre der Stagnation (zastoj). Der vermeintliche Stillstand dieser Zeit in politischer, sozialer und kultureller Hinsicht lässt sich jedoch nur schwer mit den nostalgischen Gefühlen in Einklang bringen, die ehemalige Sowjetbürger in der Rückschau auf jene Zeit hegen. Die Zeit der Stagnation erscheint vielen der „letzten sowjetischen Generation“ als Zeit der Ruhe, der Normalität. Am Beispiel von Arbeit möchte ich jenes Lebensgefühl der damaligen Zeit einfangen. Arbeit war die zentrale Kategorie des sowjetischen Staates; Arbeit sollte „das erste Lebensbedürfnis des sowjetischen Menschen“ werden (XXII. Parteitag der KPdSU 1961).
Wie Menschen ihre Arbeit tatsächlich wahrnahmen, wie sich soziale Beziehungen durch die Arbeit konstituierten, welche Rolle Arbeit im Leben eines sowjetischen Bürgers tatsächlich spielte, sind die erkenntnisleitenden Fragen dieses Buchprojektes. Die Möglichkeiten reichten von Identifikation mit der Arbeit bis zur offensiven Arbeitsverweigerung. Viele SowjetbürgerInnen empfanden ihre Arbeit schlicht als Job, als Mittel zum Zweck und nicht wie von der sowjetischen Führung erträumt als Erfüllung, als eigentlichen Zweck des Daseins. Komödien oder Songtexte der 1970er Jahre spiegeln diesen Bezug zur Arbeit wider. Statt zum ersten Lebensbedürfnis wurde Arbeit zum Witz, zum Objekt des Spotts. Arbeit und Arbeitsplatz waren für viele SowjetbürgerInnen weder der vorrangige Ort zum Erwerb des Lebensunterhaltes noch der Ort für Selbstbestätigung. Was aber war dann Arbeit überhaupt noch in der Sowjetunion? Meine Kulturgeschichte der Arbeit wird versuchen, diese Frage zu beantworten.
Länder-Analysen
Die Länder-Analysen bieten regelmäßig kompetente Einschätzungen aktueller politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. Alle Länder-Analysen können kostenlos abonniert werden und sind online archiviert.
» Länder-Analysen
» Eastern Europe - Analytical Digests
» Länder-Analysen
» Eastern Europe - Analytical Digests
Discuss Data
Archiving, sharing and discussing research data on Eastern Europe, South Caucasus and Central AsiaOnline-Dossiers zu
» Erdgashandel
» Hier spricht das Archiv
» Russian street art against war
» Dissens in der UdSSR
» Duma-Debatten
» 20 Jahre Putin
» Protest in Russland
» Annexion der Krim
» sowjetischem Truppenabzug aus der DDR
» Mauerfall 1989